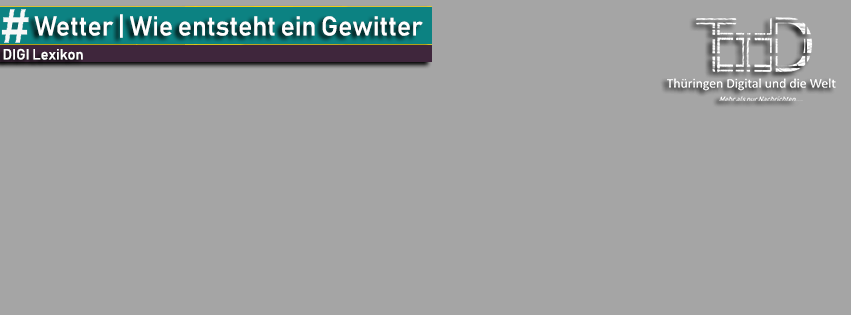Gewitter können entstehen, wenn eine hinreichend große vertikale Temperaturabnahme in der Atmosphäre vorhanden ist, d. h. wenn die Temperatur mit zunehmender Höhe so stark abnimmt, dass ein Luftpaket durch Kondensation instabil wird und aufsteigt.
Dafür muss die Temperatur pro 100 Höhenmeter um mehr als 0,65 K abnehmen.
Ein aufsteigendes, auskondensiertes Luftpaket kühlt sich beim Aufstieg um ca. 0,65 K/100 m ab.
Durch die freiwerdende Kondensationswärme kühlt es dabei jedoch weniger schnell, als die umgebende Luft ab.
Dadurch wird es wärmer und damit, aufgrund der dichten Abnahme, leichter als die Umgebungsluft - ein Auftrieb wird erzeugt.
Aus diesem Grund ist für die Entstehung eines Gewitters eine feuchte Luftschicht in Bodennähe notwendig, die über die latente Wärme den Energielieferanten für die Feuchte darstellt und somit die Gewitterbildung überhaupt erst ermöglicht.
Die latente Wärme ist, die im Wasserdampf verborgene Energie, die bei der Kondensation in Form von Wärme freigesetzt wird.
Sind die Grundbedingungen (geeignete Temperaturschichtung und Feuchte in Bodennähe) für ein Gewitter erfüllt, muss nicht zwangsläufig eines entstehen.
Erst die Hebung der feucht-warmen Luftschicht am Boden löst ein Gewitter aus.
Dafür sind Faktoren wie Wind-/ und Luftdruckverhältnisse, die Topographie, sowie die Luftschichtung relevant. Da einige dieser Faktoren durch Vorhersage-Modelle schwierig vorauszuberechnen sind und von Ort zu Ort stark variieren, ist die Vorhersage von Gewittern außerordentlich schwierig. Auch der Klimawandel scheint einen Einfluss auf die Entstehung von Gewittern zu haben.
Thüringen Digital Redaktion